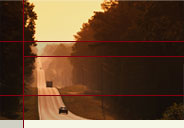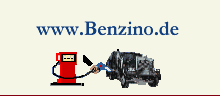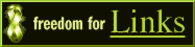Die Mazenauer-Maschine
18.04.2002 Die
Tornadomaschine basierte auf einem Konzept, das
der 1989 verstorbene Schweizer Erfinder Hans Mazenauer
zu Beginn der siebziger Jahre entwickelt hatte. Der
Erfinder war von Beruf lntarsienschreiner, hatte dann
später Tiefbauzeichner hinzugelernt. Aus einem Gespräch
der Autoren mit seiner Frau im Jahr 1995 ging hervor,
dass ihm die Idee zu dieser Maschine im Traum
übermittelt worden sei.
Schon immer ein begabter Tüftler, erfand er eine
sichere Anbindung für die Tiere im Stall, die bei
Brandgefahr aufgrund der Auslösung des Brandmelders
sofort freigeschaltet wurde. Nachdem er die Inspiration
zum Tomado- motor erhalten hafte, widmete er seine ganze
Zeit und Energie diesem Projekt.
Die
Konstruktionsgrundlagen brachte er im Februar 1974 zu
Papier. In jahrzehntelanger Arbeit entwickelte er
verschiedene Prototypen und liess sie bauen. Dieses
Projekt wurde von verschiedenen Investoren, aber
massgeblich von einem Bekannten der Autoren, einem
Hotetier im Berner Oberland, gesponsert und von der
mechanischen Werkstätte K. W. AG in Bern
realisiert.
Interviews mit Investoren,
Konstrukteuren, Mitarbeitern und der Witwe von Hans
Mazenauer bestätigten, dass der aus Kupferblech gebaute
Rotor mit einem maximalen Durchmesser von ca. 550 mm
wirklich funktioniert hafte. Der aus einem Doppelkegel
mit Innen- und Aussenmantel konstruierte Rotor enthielt
in der Zwischenwand spiralig geführte Luftkanäle, welche
die im ersten Kegel eingesaugte Luft (wie bei einem
Tornado) verdichteten und im zweiten Kegel spiralig
tangential ausstiessen.
Folgende Arbeitsphasen
des Mazenauer-Rotors waren vorgesehen:
- Während der Startphase wird der senkrecht stehende
Rotor mittels eines Motors extern angetrieben und über
die schraubenförmigen Einlasskanäle Luft von unten
eingesogen (die Drehrichtung muss stimmen).
- Mit wachsender Drehzahl werden die Luftpakete im
oberen Kegel aufgrund der Fliehkraft tangential schräg
nach oben in einer Spirale ausgestossen. Hierdurch
ergibt sich ein Sog, das heisst eine
Luftdruckabsenkung im Mittelteil des Rotors, wodurch
wiederum verstärkt Luft von unten eingesogen wird.
- Die Luftdruckabsenkung bewirkt eine gleichzeitige
Temperaturabnahme. Die abgekühlten Luftmassen sinken
im Aussenraum spiralig nach unten und werden erneut
vom Rotor eingesogen und weiter abgekühlt. Der axial
wirkende Sog des Rotors bewirkt, dass die eingesogenen
Luftmassen aufgrund der schraubenförmigen
Luftkanalführung den Rotor zusätzlich antreiben, das
heisst, es ist zunehmend weniger externe
Antriebsleistung erforderlich. Bei etwa 10‘OOO-l 2.OOO
U/min.
- - je nach Rotorausführung und Luftbedingungen -
wird der Rotor selbstlaufend und muss gebremst bzw.
auf eine stabile Drehzahl
- Die Luftpakete erfahren einerseits eine senkrechte
schrauben-förmige, spiralige Aufwärtsbewegung im
Rotorinnem mit senkrechter Achse. Gleichzeitig
entsteht durch das Absinken der kalten Luft von oben
nach unten im Aussenraum eine kreisförmige bzw. ovale
Bewegung um eine horizontale Achse aufgrund der
Drehung des Rotors um die vertikale Achse. Das heisst,
auch im Aussenraum setzt sich die spiralige Bewegung
fort. Damit entsteht für die Luftströmung eine
“geschlossene“ Spiralbahn, wie sie auch bei Strudeln
und Tornados auftritt. Die Bewegung der Luftmassen
ähnelt übrigens den mechanischen
Doppelkreiselpatenten, die von ver- schiedenen
Erfindern vorgestellt wurden und eine Energiegewin-
nung aus der Kombination Gravitation/Fliehkräfte
ermöglichen sollen (5. Abschnitte “Kreiseleffekte‘ im
3. und 5. Kapitel).
Der Tag, an dem der Motor zum Generator
wurde
Über Thomas M., heute Geschäftsleiter
eines Schweizer Radiosen- ders und seinerzeitiger
Mitarbeiter Mazenauers, war zu erfahren, was an dem Tag
Ende der siebziger Jahre in der genannten Berner
Werkstatt passiert ist.
“Die Idee war, dass der Kegel
mit dem grossen Durchmesser die Luft ansaugt, damit man
eine möglichst grosse Verdichtung erreicht Der
Antriebsmotor war regelbar, er lief direkt am Netz über
den Regler, die Drehzahl wurde mit einem Handinstrument
gemessen, man hafte auf der Achse eine dunkle Markierung
angebracht Der Rotor wurde über den Riemen vom
Elektromotor angetrieben. Es wurde ein optisches
Handmessgerat verwendet mit Fotosensor. Die
Leistungsaufnahme des Motors wurde nicht gemessen. Die
Drehzahl, die noch erfasst wurde, lag bei 6000-6500 Ulm.
Danach ist es immer lärmiger geworden; es tönte, wie
wenn ein Düsenflugzeug tief fliegt. Der Rotor stand frei
in der Maschinenhalle, das heisst in einer
blechbedeckten Halle, in der sogar die Wände aus Blech
waren. Die Leute bekamen Angst, versteckten sich hinter
Sandsöcken. In dem allgemeinen Lärm, als der Rotor die
Grenze überschritt, veränderte sich das Geräusch, es
tönte wie ein dumpfes Knurren. Es war eine Sache von
Sekunden, vielleicht einer halben Minute, wo man das
Gefühl bekam, dass der Rotor versuchte, es selber zu
schaffen. Dann kam jemand auf die Idee: jetzt stoppt den
Motor! Da ist Mazenauer kurz entschlossen hin gerannt
und hat unter den Antriebs riemen einen Stab geschoben.“
9)
Vom Werkstattchef war eine etwas andere Version zu
vernehmen (vielleicht handelt es sich auch um einen
anderen Versuch):
«Nach Fremdantrieb des - senkrecht
stehenden - Rotors über einen Elektromotor wurde dieser
bei ca. 3000 Ulmin abgekoppelt Danach ging die Drehzahl
erst leicht zurück, um dann plötzlich unerwartet
zuzunehmen. Diese Steigerung erfolgte ohne äusseren
Antrieb in einer
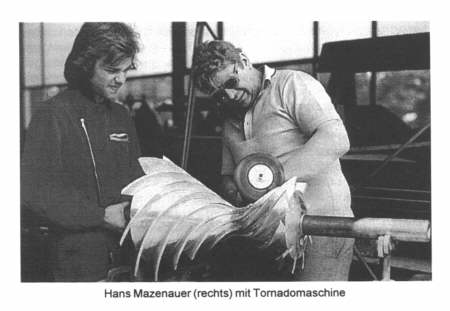
nichtlinearen Weise, das heisst,
sie erhöhte sich jeweils in bestimmten oktavähnlichen
Stufen, innerhalb von 2-3 Minuten. Da keine Massnah- men
zur mechanischen Bremsung vorgesehen waren, wurde ein
Bersten des Rotors befürchtet, weshalb die beteiligten
Personen, ausser ich selber und H. Mazenauer, den
Testraum rasch verliessen.
Bei einer geschätzten
Drehzahl von ca. 17000 Ulmin lieferte der Rotor über den
erst ab- und dann zur Bremsunterstützung wieder
angekoppelten Motor, der nunmehr als Generator lief,
elektrische Leistung ins Netz zurück. Nach kurzer Zeit
brannten die Sicherungen - offenbar die Heu ptsicherun
gen - nicht nur im Gebäude durch, sondern der Stromstoss
führte zu einem Ausfall des Stmmnetzes im Quartier. Im
abgedunkelten Raum, wo der Rotor immer noch lief, war
deutlich eine Art Elmslicht zu sehen, insbesondere im
Turbinenbe reich, mit einem bläullch-weissen Schimmer.
Schliesslich wurde der Rotor als Folge der Fliehkröfte
mechanisch zerstört Reste davon sind heute keine mehr
vorhanden.“ 10)
Nach seiner Erinnerung soll über den
Vorfall auch ein Bericht im
«Bllck‘ erschienen sein.
Er selber sei dann mehrfach - offenbar als Folge von
Pressemeldungen - auf Reisen in USA/Kalifornien von
Personen und Firmen angesprochen worden, die sich
intensiv für den Mazenauer-Rotor interessierten. Ein
deutscher Physiker aus dem süddeutschen Raum hatte noch
zu Lebzeiten Hans Mazenauers mehrfach mit ihm Kontakt
gehabt und sich ebenfalls für das Projekt
begeistert.
In dieser Zeit - als der Motor zum
Generator wurde und das Stromnetz ausfiel - soll nach
der Erinnerung von Frau Mazenauer eines
Morgens gegen
7.45 Uhr auf dem Schweizer Radio ein Interview mit ihrem
Mann gesendet worden sein. Recherchen der Autoren bei
Radio
DRS ergaben kein Resultat.
An eine
Neukonstruktion war nicht mehr zu denken, weil das Ganze
sehr teuer war (total ca. 3 Mio Fr.). Vor Gram über die
misslungenen Versuche ergab sich der Erfinder dem
Alkohol und starb dann, ohne die Experimente wieder
aufgenommen zu haben. Nach dem Tode von Hans Mazenauer
1989 gingen die Akten an den Sponsor im Berner Oberland
über, der am meisten investiert hatte, und blieben dann
lange liegen, bis ihn der Zufall mit den Autoren dieser
Zeilen zusam- menführte. Diese konnten die Akten
einsehen und lasen dort zum Beispiel, was Hans Mazenauer
über das Konzept geschrieben hatte:
“Meine
Grundidee zur Erfindung des vorliegenden Rotors, der
eine saubere Energie liefert, liegt in der Natur Die
Natur selbst bringt ein ungeheures Reservoir an noch
nicht ausgenutzten Energie formen. Der Ausgangspunkt,
diese Energien ausnutzen zu können, liegt schon in der
Form des zu konstruierenden Apparates. Es galt also,
diese Form zu finden und jede Grösse in ein Verhältnis
zur anderen zu bringen. Dieses Verhältnis ist überall in
der Natur anzutreffen, und es ist die ‘kosmische
Harmonie‘~ der ‘Goldene Schnitt‘. Durch dieses
Verhältnis entstand schliesslich die ‘Idealform‘ des
Rotors, in der nichts dem Zufall überlassen blieb,
sondern alles und jedes in ein Verhältnis zueinander
gebracht wurde...
Durch die natw-gerechte Bewegung,
die radial-axiale Eindrehung des Mediums Luft als
Energieträger, entsteht ein Rotationssog. Dieser Sog
erzeugt ein Vakuum, was eine annähernd reibungslose
Gesch win- digkeitssteigerung zur Folge hat..
Die auf
solche Weise gewonnene Energie ist absolut sauber. In
einem geschlossenen Kreis/auf kann die gleiche Luft
immer wieder verwendet werden, da sie in ihrem inneren
Aufbau nicht geschädigt wird. Das heisst auch, dass der
vorliegende Rotor weitgehend wartungsfrei ist er
benötigt keine Treibstoffe wie Benzin, Diesel, Öl, Gas
usw... Nur durch die Vollkommenheit in Form und
Bewegungsab- lauf ist es möglich, dass sich der Rotor
durch seine eigene Energleentwicklung selber in einer
Drehbewegung erhält und weiter keine Energiezufuhrim
herkömmlichen Sinne mehr benötigt..
Hans Mazenauer,
CH 3280 MurtenI38O6 Bönigen, im Februar 1974“
Die
Autoren studierten die Akten eingehend und gelangten zur
Erkenntnis, dass es möglich sein sollte, das Gerät
nachzubauen und zur Funktion zu bringen. Anfragen in der
Werkstatt KW. AG ergaben, dass ein Nachbau in derselben
Grösse und mit dem gleichen Verfahren (zeitaufwendige
Metallbearbeitung) nach heutigen Lohnkosten ca. Fr.
150000.- kosten würde. Es wurde daher nach einem
günstigeren Verfahren gesucht, und in einer Phase, als
die Gründung der TransAltec AG schon geplant war, Gelder
gesammelt, um einen solchen Rotor in Stereolythtechnik
nachzubauen. Es handelt sich um ein lasergesteuertes
Verfahren, mit dem aus flüssigem Epoxidharz schichtweise
ein 3-D-Modell aufgebaut wfrd, das als vollwertiger
Prototyp einsetzbar ist.
Abschätzungen ergaben,
dass zum Erzielen ähnlicher Effekte, wie sie Hans
Mazenauer erreicht hatte, ein Epoxidharz-ModelI mit
einem maximalen Durchmesser von 220 mm ausreichen
müsste. Mit zusätzticher Glasfaserverstärkung sollte
dieser Prototyp bei einer Drehzahl bis zu max. 1 5‘OOO
U/m betrieben werden können. Damit ergab sich eine
gleich grosse Luftausstossgeschwindigkeit wie bei der
Original-Mazenauer-Turbine (6‘OOO UlMin). Die
Herstellkosten eines solchen, um den Faktor 2,5
kleineren Prototypen waren 6mal günstiger.
Im
Frühling 1996 war es so weit: der Rotor wurde dem Autor
durch die Aarauer Firma, die den Prototypen gebaut
hatte, übergeben. Wenige Tage danach wurden in der
Werkstatt von Bernhard Wälti, eines Freundes der Autoren
und ehem. Assistent des Physikalischen Instituts der Uni
Bern, die ersten Tests durchgeführt. Bnige Testläufe
fanden - wegen Berstungsgefahr - im Garten stall.
Es
zeigte sich allerdings bald, dass die Luftkanäle durch
die Verkleinerung um den Faktor 2,5 (Gesetz von
Hagen-Poisseuille) einen um 2,5k = 39fach erhöhten
Durchgangswiderstand der Luft aufwiesen.
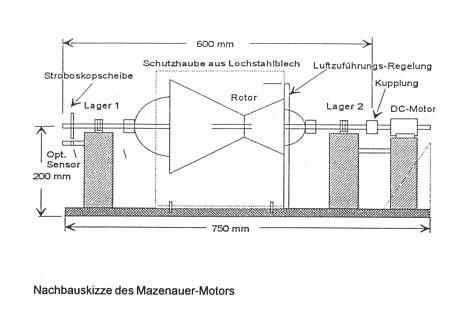
Ob die Rotationsgeschwindigkeit nun
4‘OOO oder 8‘OOO U/Min. U/Min. betrug: mit einigen
Schwankungen war der Effekt stets der gleiche: statt
dass Luft durch die Ein lasskanäle eingesogen wurde,
sich im Innern des Rotors in pulsierende Bewegung
versetzt und damit dem Rotor zu einem natürlichen
Antrieb verholfen hätte, bildete sich vor den
Eintasskanälen ein Luftpolster, das mit zunehmender
Geschwindigkeit immer störender wurde. Es hatte deshalb
gar keinen Sinn, den Rotor auf 1 5‘OOO Umdrehungen pro
Minute hochzutreiben.
Im Laufe der folgenden Wochen
wurden verschiedene Massnahmen getroffen, um die Luft
dazuzubringen, den Weg durch die - offenbar zu engen -
Einlasskanäle anzutreten - vergeblich!
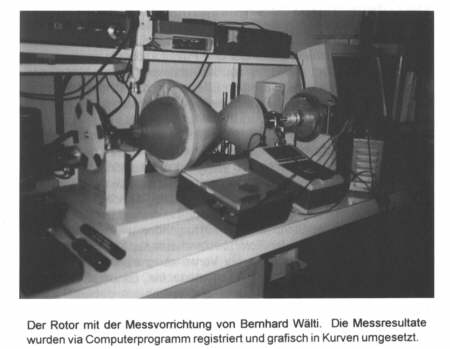
Quelle Adolf und Inge Schneider
Energie aus dem All
Das Geheimniss einer neuen
Energiequelle
welches direkt bei den Autoren
bestellen können.
welches direkt bei den Autoren bestellen
können.
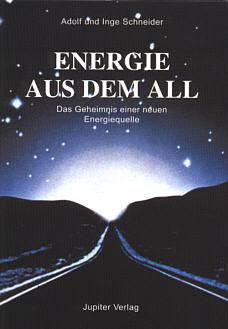
[ aktuelle
Nachrichten ] [ Nachrichten-Archiv
] [ Druckansicht ]